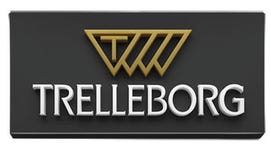Beachten Sie unser aktuelles Angebot!

Jetzt voller Energie und ohne Ausreden in die neue Sprache starten.
Winter Special: Melden Sie sich bis zum 29.2.24 an und sparen Sie 20% auf den regulären Preis!

Berlitz Flex – Online Self-Study + Live Coaching
Unser neues Sprachtraining für maximale Freiheit und Flexibilität
Kursangebot
Bei uns können Sie nicht nur eine neue Sprache lernen: Unser Berlitz Sprachenzentrum bietet eine Reihe von Sprachkursen und interkulturelle Trainings für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Unternehmen und mehr. Wählen Sie aus den folgenden Optionen, um Ihren idealen Kurs zu finden.
Was unsere Kunden sagen
Das erzählen unsere Kunden über Berlitz
Ich habe immer gezögert, eine neue Sprache zu lernen, aber die Berlitz Sprachschule hat meine Sichtweise komplett verändert. Der persönliche Ansatz und die qualifizierten Lehrkräfte machten den Prozess nicht nur angenehm, sondern auch unglaublich effektiv. Innerhalb weniger Monate konnte ich eine deutliche Verbesserung meiner Sprachkenntnisse feststellen, die es mir ermöglichte, selbstbewusst mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Die immersiven Lehrmethoden von Berlitz wirken wirklich Wunder!
Berlitz Partner
Ein Auszug von Firmen, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Füllen Sie das Formular aus, um Ihr persönliches Angebot zu erhalten!
Füllen Sie das folgende Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten. Ein Berlitz-Mitarbeiter wird sich in Kürze bei Ihnen melden.

.jpg?auto=webp&format=pjpg&quality=80&width=640&height=640&fit=crop&crop=640:480,smart)
.jpg?auto=webp&format=pjpg&quality=80&width=640&height=640&fit=crop&crop=640:480,smart)




.jpg?auto=webp&format=pjpg&quality=80&width=auto&height=150&fit=bounds?auto=webp&format=pjpg&quality=80&width=auto&height=150&fit=bounds)